Daten sind längst der unsichtbare Rohstoff der modernen Logistik. Sie steuern Touren in Echtzeit, melden Wartungsbedarfe, berechnen optimale Lagerplatzverteilungen und verbessern durch KI-Unterstützung sogar die Kundenzufriedenheit.
Doch obwohl Logistikunternehmen unzählige digitale Berührungspunkte erzeugen, hatten sie bislang oft keinen echten Zugriff auf die entstehenden Daten – oder mussten dafür teuer bezahlen.
Hier setzt der EU Data Act an:
Er will die Hoheit über Nutzungsdaten zurück in die Hände derer legen, die sie durch ihre Tätigkeit eigentlich erzeugen – also auch und gerade in die Hände von Logistikern. Für die Logistikbranche ist der EU Data Act damit nicht nur ein regulatorisches Rahmenwerk, sondern ein echtes Instrument zur digitalen Selbstbestimmung.
Warum braucht es den EU Data Act überhaupt?
In der Praxis haben sich über Jahre technologische Abhängigkeiten aufgebaut: Hersteller von Fahrzeugen, Maschinen oder Softwaresystemen – sogenannte OEMs und Plattformbetreiber – sammeln systematisch die Nutzungsdaten aus ihren Produkten, halten sie aber oft unter Verschluss oder verlangen hohe Gebühren für den Zugang. Gleichzeitig fehlen standardisierte Schnittstellen, um diese Daten in unternehmenseigene Systeme zu integrieren.
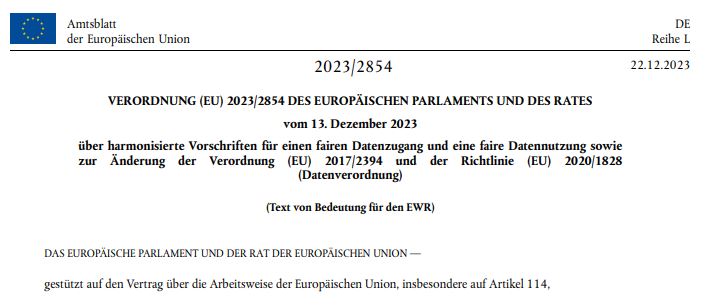
Dadurch entsteht eine ungesunde Machtasymmetrie: Obwohl Logistiker Eigentümer oder Betreiber der eingesetzten Technik sind, können sie die wertvollen Informationen daraus oft gar nicht oder nur eingeschränkt nutzen. Viele dieser Daten könnten enorme Potenziale für Effizienzsteigerung,
Automatisierung oder Innovation bergen – doch sie bleiben im sogenannten „data lock-in“ gefangen. Der EU Data Act wurde eingeführt, um diesen Zustand zu beenden und eine gerechte Verteilung von Datenzugangsrechten zu schaffen.
Was sind „vernetzte Produkte“ im Sinne des EU Data Act?
Der EU Data Act richtet sich explizit an Produkte, die während ihres Gebrauchs Daten erzeugen und über digitale Schnittstellen mit anderen Systemen verbunden sind. In der Logistik zählen dazu unter anderem:
- Telematiksysteme in Lkw und Trailern
- Sensorik in Lagern (z. B. Temperatur-, Füllstand- oder Bewegungssensoren)
- IoT-Geräte wie Paletten-Tracker, Beacons oder smarte Regale
- Digitale Dienste wie Flottenmanagement-, Lagerverwaltungs- oder Tourenplanungssysteme
- Embedded Software in Fördertechnik, Verpackungsmaschinen oder autonomen Fahrzeugen
Diese vernetzten Produkte sind heute fester Bestandteil fast jeder logistischen Wertschöpfungskette – aber der Datenfluss aus ihnen heraus ist oft nicht geregelt oder nicht zugänglich. Genau hier greift der EU Data Act ein.
Ziel: Fairer Zugang zu Daten für alle Beteiligten
Die Europäische Union will mit dem EU Data Act ein Gleichgewicht schaffen: Der Zugang zu maschinell erzeugten Nutzungsdaten soll künftig nicht mehr vom Wohlwollen des Geräteherstellers abhängen, sondern als grundlegendes Nutzerrecht gesetzlich verankert sein.
Gerade für Logistikunternehmen bedeutet das mehr Transparenz, weniger Abhängigkeit und vor allem die Möglichkeit, Daten endlich systematisch für operative und strategische Zwecke einzusetzen – sei es zur Prozessoptimierung, zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle oder zur Verbesserung der Zusammenarbeit mit Partnern entlang der Supply Chain.
Der EU Data Act ist damit kein optionales IT-Thema, sondern ein zentrales strategisches Thema für die Logistik der Zukunft.
Was regelt der EU Data Act konkret?
Der EU Data Act wurde am 11. Januar 2024 als EU-Verordnung verabschiedet und gilt ab September 2025 unmittelbar in allen Mitgliedsstaaten. Er zielt darauf ab, den Zugang zu und die Nutzung von nicht-personenbezogenen Daten aus vernetzten Produkten und damit verbundenen Diensten zu regeln.
Die Verordnung soll sicherstellen, dass Daten nicht länger ein exklusives Gut der Hersteller oder Plattformbetreiber bleiben, sondern auch von Nutzern, Dienstleistern und Wettbewerbern sinnvoll verwendet werden können.
Klare Rechte für Nutzer vernetzter Produkte
Nutzer – also zum Beispiel Speditionen, Lagerbetreiber oder Logistikdienstleister – haben künftig das Recht, auf die von ihnen erzeugten Daten zuzugreifen und diese an Dritte weiterzugeben.
Wichtig: Dieses Recht gilt auch dann, wenn die Daten zunächst vom Hersteller erfasst und gespeichert wurden. Damit wird ein zentraler Paradigmenwechsel in der Datenwirtschaft eingeleitet.
Pflichten für Hersteller und Anbieter
Hersteller vernetzter Produkte sind verpflichtet, technische Schnittstellen bereitzustellen, die den einfachen, sicheren und standardisierten Datenexport ermöglichen. Die Daten müssen „in Echtzeit, kontinuierlich und kostenlos“ zur Verfügung gestellt werden – ein Satz, der in der Logistik aufhorchen lässt.
Die DVZ weist in ihrer Analyse vom 30.07.2025 darauf hin, dass dies insbesondere OEMs unter Druck setzt, ihre bisherigen Geschäftsmodelle zu überdenken.
Vorgaben zur Weitergabe und Drittnutzung
Der EU Data Act regelt auch, wie Dritte – also z. B. IT-Dienstleister, Plattformen oder Partner in der Lieferkette – Daten im Auftrag des Nutzers verwenden dürfen. Es müssen klare Vereinbarungen zur Datennutzung, zum Schutz vertraulicher Informationen und zu Sicherheitsanforderungen getroffen werden. Das schafft Rechtssicherheit, aber auch neue Pflichten für alle Beteiligten.
Cloud-Portabilität & Anti-Lock-in
Ein weiterer zentraler Punkt: Nutzer sollen Cloud-Dienste leichter wechseln können. Der EU Data Act schreibt vor, dass Anbieter von Cloud- und Edge-Services den Wechsel zu anderen Diensten erleichtern müssen – technisch wie auch vertraglich. Für viele Logistikunternehmen, die heute in komplexen Softwarelandschaften arbeiten, ist das ein echter Gamechanger: Der Wechsel von einem TMS oder WMS soll künftig deutlich einfacher möglich sein, ohne Datenverluste oder langwierige Migrationsprojekte.
Insgesamt schafft der EU Data Act somit erstmals einen einheitlichen Rechtsrahmen, der den Zugang zu industriellen Nutzungsdaten fair, transparent und rechtssicher regelt – mit direkten Auswirkungen auf die digitale Praxis in der Logistikbranche.
Welche Auswirkungen hat das auf die Logistikbranche?
Die Logistik ist eine der datengetriebensten Branchen Europas – kein anderer Bereich produziert, nutzt und bewegt so viele Informationen entlang der Wertschöpfungskette. Doch was nützen all diese Daten, wenn sie nicht zugänglich sind? Genau hier setzt der EU Data Act an.
Er verändert die Spielregeln grundlegend: Statt im Datenschatten von Herstellern, Plattformen oder Cloudanbietern zu agieren, bekommen Logistiker endlich den Schlüssel in die Hand, um auf ihre eigenen Nutzungsdaten zuzugreifen – und sie gezielt einzusetzen.
Der EU Data Act ist keine abstrakte Regulierung, sondern ein praxisrelevanter Hebel für mehr Transparenz, Effizienz und Unabhängigkeit. Wer heute Lager, Fahrzeuge oder digitale Tools einsetzt, hat künftig ein verbrieftes Recht auf die Daten, die dabei entstehen – und kann daraus echten operativen und strategischen Mehrwert generieren.
Neue Verantwortung in der Datenkette
Zukünftig müssen alle Beteiligten entlang der logistischen Wertschöpfungskette klären, wem welche Daten gehören, wer auf sie zugreifen darf – und wie die Weitergabe technisch wie rechtlich abgesichert wird. Für Logistiker bedeutet das:
- Verträge mit IT-Dienstleistern und Plattformen müssen auf Datenportabilität und Nutzungsrechte geprüft werden.
- Eigene Systeme sollten überprüft werden, ob sie Datenzugänge in beide Richtungen – Import wie Export – unterstützen.
- Neue Rollen wie „Data Steward“ oder „Datenrechtsbeauftragter“ könnten notwendig werden.
Machtverschiebung durch Datenzugang
Viele Logistikunternehmen sind heute in einer digitalen Sackgasse: Sie erzeugen über ihre tägliche Arbeit eine Vielzahl an wertvollen Betriebsdaten – etwa aus Telematiksystemen, automatisierten Lagern oder digitalen Versandlösungen – doch der Zugriff darauf bleibt ihnen oft verwehrt. Plattformanbieter, OEMs oder Cloudlösungen kontrollieren diese Datenströme, schotten sie ab oder machen den Zugang kompliziert und teuer.
Der EU Data Act dreht dieses Machtverhältnis nun um. Wer ein Fahrzeug, eine Maschine oder ein System betreibt, soll künftig auch das Recht auf die dabei erzeugten Daten haben – und sie nicht nur einsehen, sondern aktiv weiterverarbeiten und teilen dürfen. Das ist nicht nur eine juristische Neuregelung, sondern ein praktischer Gamechanger für viele Logistiker.
Konkretes Beispiel: Ein Lagerbetreiber, der ein automatisiertes Fördersystem nutzt, bekommt künftig Zugriff auf die Betriebsdaten der Anlage – etwa Ausfallzeiten, Energieverbrauch oder Störungsmeldungen. Diese Informationen kann er direkt ins eigene WMS oder BI-System integrieren, um präventiv zu warten, Prozesse zu verbessern oder Dienstleister objektiv zu bewerten.
Ein weiteres Beispiel: Ein 3PL-Dienstleister, der die Flotte eines Kunden mit betreibt, kann künftig auf die Telematikdaten der Fahrzeuge zugreifen – auch wenn diese vom OEM erhoben werden. Damit kann er Touren dynamisch anpassen, CO₂-Emissionen live tracken oder Zustandsdaten in eigene Tools übernehmen.
Gerade in der Kontraktlogistik, bei 3PL/4PL-Dienstleistern oder in Logistiknetzwerken wird das zur entscheidenden Frage: Wer erhält Zugriff auf Daten aus vernetzten Maschinen, Fahrzeugen oder Plattformen – und unter welchen Bedingungen? Der EU Data Act liefert darauf nun erstmals eine klare und rechtlich verbindliche Antwort – zugunsten derjenigen, die operativ arbeiten und Wertschöpfung erzeugen.
Kosten, Compliance und Chancen
Der Data Act bringt auch Pflichten mit sich: Unternehmen müssen künftig sicherstellen, dass sie sowohl technisch als auch organisatorisch auf den transparenten und standardisierten Umgang mit Daten vorbereitet sind.
Dazu gehören nicht nur juristische Anpassungen, sondern auch Investitionen in IT-Infrastruktur, Datensicherheit, Mitarbeiterschulungen und vertragliche Absicherungen. Das mag auf den ersten Blick wie ein Kostenfaktor erscheinen – doch tatsächlich eröffnet es enorme Chancen für die Weiterentwicklung des Geschäfts.
Denn wer jetzt aktiv wird, kann sich klare strategische Vorteile sichern:
- Entwicklung datenbasierter Zusatzservices: Logistiker können ihre Leistungen um datengetriebene Angebote erweitern – etwa Zustandsmonitoring bei Fahrzeugen, automatische Temperaturüberwachung in der Frischelogistik oder standortübergreifende Analyse-Dashboards für Kunden.
- Integration neuer Partner über standardisierte Schnittstellen: Der EU Data Act fördert einheitliche Datenformate, was die Einbindung neuer Dienstleister oder Kunden erheblich erleichtert. Ein Logistiker kann beispielsweise in Echtzeit die Lagerverfügbarkeit beim Lieferanten einsehen und so Bestellungen dynamisch priorisieren.
- Bessere Transparenz in Echtzeitprozessen: Durch den erleichterten Datenzugriff lassen sich operative Abläufe lückenlos überwachen – etwa bei der Verfolgung von Transportzeiten, Füllständen im Lager oder Auslastungen von Umschlagplätzen. Entscheidungen können dadurch fundierter, schneller und kundenorientierter getroffen werden.
Beispiel aus der DVZ (30.07.2025): Ein mittelständischer Logistiker konnte über den EU Data Act erstmals direkt auf die Telematikdaten seiner Miet-Lkw zugreifen und diese mit dem eigenen TMS verknüpfen. Die resultierenden Einsparungen in der Tourenplanung beliefen sich laut interner Analyse auf rund 12 % – allein durch Zugriff auf bereits erzeugte, bislang aber blockierte Daten.
Langfristig gilt: Wer die Pflicht zur Compliance nutzt, um strukturell in die eigene Datenkompetenz zu investieren, wird nicht nur dem Gesetz gerecht – sondern auch resilienter, attraktiver für Partner und effizienter im Tagesgeschäft.
Welche Chancen bietet der EU Data Act?
Während viele Unternehmen zunächst die Risiken und Pflichten im Blick haben, bietet der EU Data Act vor allem eines: riesige Potenziale. Gerade für mittelständische Logistiker ohne eigene Plattform oder OEM-Struktur eröffnen sich neue Spielräume für digitale Unabhängigkeit und Innovation.
Operative Effizienz durch Echtzeitdaten
Wenn Logistiker in Echtzeit auf Maschinendaten, Zustandsinformationen oder Leistungswerte zugreifen können, entstehen ganz neue Möglichkeiten zur Prozessautomatisierung, vorausschauenden Wartung und dynamischen Ressourcensteuerung.
So können etwa bei einer Paket-Sortieranlage Daten zu Störungen, Laufzeiten oder Temperatur automatisch erfasst und direkt ins eigene Lagerverwaltungssystem (WMS) eingespeist werden. Anstatt externe Dienstleister oder Drittportale einzubinden, fließen diese Informationen in Echtzeit ins firmeneigene IT-Ökosystem – vom Wareneingang über die Zwischenpufferung bis hin zum Versand.
Ein praktisches Beispiel: Ein Kühlkettenlogistiker erhält durch den direkten Zugriff auf die Temperaturdaten seiner Transportcontainer die Möglichkeit, auf Temperaturabweichungen unmittelbar zu reagieren – noch bevor es zu Produktverlusten kommt. Solche Reaktionszeiten waren bisher oft nicht möglich, da die Daten vom Hersteller oder externen Plattformbetreibern kontrolliert wurden.
Durch den EU Data Act werden solche direkten Datenflüsse künftig zum Standard – und sorgen für mehr Kontrolle, Geschwindigkeit und Wirtschaftlichkeit im operativen Tagesgeschäft.
Neue Geschäftsmodelle und Services
Wer Zugriff auf Daten hat, hat mehr als nur Informationen – er hat die Grundlage für neue, datenbasierte Geschäftsmodelle in der Hand. Logistikdienstleister können durch den EU Data Act erstmals aktiv gestalten, welche Daten sie nutzen, wie sie diese veredeln und in innovative Services verwandeln.
Ein Beispiel: Im Bereich Predictive Maintenance können Logistiker über den direkten Zugang zu Maschinendaten – etwa Temperaturverläufe, Vibrationen oder Auslastung – Wartungszyklen präzise vorhersagen und Ausfälle vermeiden.
Statt pauschale Wartungsintervalle einzuhalten, werden nur Maschinen gewartet, die tatsächlich Anzeichen für Verschleiß zeigen. Das spart Geld, verlängert die Lebensdauer und erhöht die Verfügbarkeit von Anlagen.
Oder im Bereich der dynamischen Tourenoptimierung: Mit Echtzeitdaten zu Verkehrslage, Ladezustand, Lieferzeitfenstern und Maschinenstatus können Touren nicht nur vorab geplant, sondern auch unterwegs neu berechnet werden – etwa bei Verspätungen, Ausfällen oder plötzlichen Kundenanfragen. Das erhöht die Servicequalität, senkt Emissionen und reduziert Leerkilometer.
Auch individuell aufbereitete Dashboards gewinnen an Bedeutung: Kunden möchten heute nachvollziehen können, wo sich ihre Ware befindet, wie die Lieferkette funktioniert oder welche Nachhaltigkeitskennzahlen dahinterstecken.
Der EU Data Act schafft die rechtliche Basis, um solche Schnittstellen zu entwickeln und als Service zu vermarkten – unabhängig davon, ob die Daten vom eigenen System oder vom Gerät eines Dritten stammen.
Kurz: Datenhoheit wird zur Produktbasis – und ermöglicht neue Geschäftsmodelle, die zuvor rechtlich oder technisch blockiert waren.
Interoperabilität durch Standards
Der EU Data Act stärkt gezielt Initiativen, die auf offene Schnittstellen, standardisierte Datenformate und eine interoperable Infrastruktur setzen – wie etwa die Open Logistics Foundation. Diese arbeitet branchenübergreifend an quelloffenen Softwarekomponenten und Referenzarchitekturen für die Logistik.
Ein konkretes Beispiel ist der „IDS Connector“, der als standardisierte Middleware entwickelt wurde, um verschiedenste Transportmanagement-, Lagerverwaltungs- oder ERP-Systeme miteinander zu verbinden – unabhängig vom Anbieter.
Quelle: Open Logistics Foundation – IDS Integration Toolbox (Connector-Komponenten)
verfügbar unter: Open Logistics Foundation GitLab
Solche Lösungen ermöglichen es Logistikunternehmen, Daten aus unterschiedlichen Quellen zu bündeln, auszuwerten und gezielt in ihre Prozesse zu integrieren – ganz im Sinne der neuen Vorgaben aus dem EU Data Act.
Wer also schon heute in interoperable Architekturen investiert, schafft nicht nur technische Zukunftssicherheit, sondern positioniert sich strategisch für die nächste Welle der Digitalisierung. Proprietäre Silos, in denen Daten eingeschlossen bleiben, verlieren an Attraktivität – sowohl für Kunden als auch für Partner entlang der Supply Chain.
Strategische Unabhängigkeit für den Mittelstand
Für viele kleine und mittlere Logistikunternehmen bietet der EU Data Act eine historische Chance: Sie können sich aus technologischen Abhängigkeiten lösen und selbstbestimmt über ihre digitalen Assets verfügen. Wer jetzt handelt, stärkt seine Resilienz – technologisch, operativ und wirtschaftlich.
In Summe wird der EU Data Act nicht nur als rechtliche Regulierung wirken, sondern als Katalysator für eine neue digitale Selbstbestimmung in der Logistik.
Was müssen Logistiker jetzt konkret tun?
Der EU Data Act ist beschlossen – und er wird kommen. Doch was bedeutet das für die konkrete Umsetzung im Alltag von Logistikunternehmen?
Wer sich jetzt systematisch vorbereitet, wird nicht nur rechtskonform handeln, sondern auch in puncto Effizienz und Datenhoheit massiv profitieren. Dabei geht es nicht darum, gleich ein Großprojekt zu starten – sondern strukturiert in fünf pragmatischen Schritten vorzugehen:
1. Dateninventur starten: Beginnen Sie mit einem strukturierten Überblick: Welche Systeme (z. B. WMS, TMS, Telematik, Lagerautomatisierung, ERP) erzeugen Daten? Welche Daten sind besonders kritisch (z. B. Temperatur, GPS, Bestandsdaten)? Wo liegen sie – intern oder bei Dienstleistern?
2. Zugriffsrechte analysieren: Wer hat derzeit Zugriff auf diese Daten? Gibt es Plattformanbieter oder OEMs, die als Gatekeeper fungieren? Liegen die Nutzungsrechte vollständig bei Ihnen? Hier helfen Vertragsprüfungen, technische Tests (API-Zugriffe) und ggf. Rücksprache mit Herstellern.
3. Verträge prüfen und anpassen: In vielen Fällen müssen bestehende Lieferverträge, Software-Lizenzen oder Service-Level-Agreements (SLAs) angepasst werden, um Ihre neuen Rechte durchzusetzen. Das betrifft vor allem Klauseln zu Dateneigentum, Nutzung, Weitergabe und Portabilität.
4. Interne Zuständigkeiten klären: Bestimmen Sie, wer im Unternehmen künftig verantwortlich ist für Datenstrategie und -zugriff. Rollen wie „Data Steward“, „IT-Schnittstellenmanager“ oder „Legal Tech Advisor“ gewinnen an Bedeutung. Ein kleines interdisziplinäres Projektteam kann die Umsetzung begleiten.
5. Erste Use Cases identifizieren: Nutzen Sie die Gelegenheit, um konkrete Mehrwertprojekte zu starten: Wo könnten bessere Datenzugänge direkt zu mehr Effizienz, Kostensenkung oder Kundenservice führen? Zum Beispiel durch die Verknüpfung von Lager- und Transportdaten, prädiktive Wartung oder die Integration von Live-Daten in Kundenportale.
Praxisbeispiel: Ein mittelständischer Kontraktlogistiker in NRW hat im Zuge des Data Act alle Telematikdaten seiner Staplerflotte mit dem Energieverbrauch und der Auslastung im Lager verknüpft – und dadurch identifiziert, welche Zonen regelmäßig ineffizient genutzt wurden. Ergebnis: Eine neue Routenplanung im Lager und über 8 % Energieeinsparung bei gleicher Taktung.
Fazit: Wer den EU Data Act aktiv angeht, wird nicht überrollt, sondern übernimmt die Kontrolle – strategisch, operativ und rechtlich.
Checkliste für den Start:
- IT-Systeme auf Datenexportfähigkeit prüfen (APIs, Schnittstellen etc.)
- Bestehende Verträge mit Plattformanbietern oder OEMs auf Datenzugriffsrechte analysieren
- Klären, ob Dienstleister oder Kunden künftig Zugriff auf eigene Daten erhalten sollen (Data Sharing Modelle)
- Rechtliche Beratung zu neuen Pflichten und Gestaltungsspielräumen einholen
- Interne Zuständigkeiten schaffen: Wer verantwortet künftig Datenhoheit und -zugänge?
Warum jetzt die Weichen gestellt werden
Der EU Data Act tritt zwar offiziell erst 2025/2026 vollständig in Kraft – doch der Handlungsdruck ist schon heute spürbar. Kunden, Partner, Investoren und Behörden fordern zunehmend Transparenz über Datenflüsse, Zugriffsrechte und digitale Verantwortlichkeiten. Wer sich jetzt vorbereitet, verschafft sich einen entscheidenden Vorsprung – nicht nur in puncto Compliance, sondern auch als attraktiver Partner im digitalen Logistikökosystem.
Die kommenden Monate sollten gezielt genutzt werden, um die eigene Datenstrategie zu überdenken, Prozesse anzupassen und technische wie organisatorische Grundlagen für einen souveränen Umgang mit Daten zu schaffen. Dabei geht es nicht allein um IT-Fragen: Der EU Data Act betrifft Einkauf (Vertragsgestaltung mit Lieferanten), Recht (Datenverträge und Eigentumsfragen), Vertrieb (datenbasierte Mehrwertservices), Betrieb (Prozesseffizienz) und Management (Strategie und Verantwortung).
Weichen stellen – aber wofür genau?
Das Zielbild ist klar: eine interoperable, transparente und selbstbestimmte Logistik, in der Unternehmen aktiv mit Daten arbeiten können – statt sie nur passiv zu erzeugen oder fremdgesteuert zu konsumieren. Künftig werden Logistiker in der Lage sein:
- Echtzeitdaten aus Maschinen, Fahrzeugen oder Sensoren direkt zu nutzen,
- Kunden individuelle Datenservices anzubieten (Dashboards, Tracking, Nachhaltigkeitsnachweise),
- interne Prozesse datenbasiert zu optimieren (z. B. Auslastung, Energieverbrauch, Kapazitätssteuerung),
- neue Geschäftsmodelle auf Basis von Datenzugriffen zu entwickeln (z. B. Pay-per-Use, Predictive Services).
Beispielhafte Zukunftsszenarien:
- Ein Spediteur bietet temperaturgeführte Transporte mit lückenloser Dokumentation und Live-Zugriff auf Containerdaten – als Premiumdienst.
- Ein Lagerbetreiber stellt Lieferanten und Kunden über APIs individuelle Leistungs- und Qualitätsdaten zur Verfügung – automatisiert und standardisiert.
- Ein 3PL-Anbieter baut ein datengetriebenes Netzwerk zur Echtzeit-Kollaboration mit Verladern auf – inklusive Visualisierung aller Umschlagsvorgänge.
Fazit: Der EU Data Act markiert den Beginn einer neuen Ära: Wer frühzeitig die nötigen Voraussetzungen schafft, entwickelt sich vom „Datenerzeuger im Maschinenraum“ zum „Datenmanager auf der Brücke“. Die Weichen sind gestellt – für eine Logistik, die nicht nur transportiert, sondern digital gestaltet.
